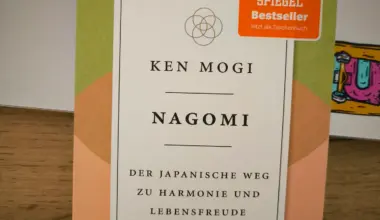In den letzten Tagen und Wochen wurde das Buch „Den Islam denken: Versuch, eine Religion zu verstehen.“ von Frank Griffel ziemlich stark beworben und von der Kritik gelobt. Ich kann das tatsächlich nach der Lektüre des Buches nicht nachvollziehen. Im Grunde haben wir es mit einer mittelmäßigen Arbeit zu tun, die weder in die Tiefe geht, noch wirklich neue Ansichten oder Einsichten in „den“ Islam liefert. Zum Verständnis der Religion des Islam taugt es wenig.
Zugegeben, den Einstieg mit Tolstoy zu wagen hat was, aber letztlich bleibt ein merkwürdiger Eindruck zurück. Griffel greift nämlich über eine Geschichte von Tolstoy auf die Frage zurück, ob Osama Bin Laden nicht für eine „islamistisch verstandene Idee von Unabhängigkeit“ (S. 11) gekämpft habe. Solche Fragestellungen sehe ich immer kritisch, weil sie letztlich dazu verleiten können Verständnis für die Taten von Terroristen aufzuzeigen. Das gesamte erste Kapitel lässt sich am Ende als eine Kritik an Imperialismus verstehen.
Lost in Text – Griffel denkt den Islam nicht neu, er schafft es nicht mal ihn zu beschreiben
Griffel will Antworten auf die Fragen liefern, was „Islam“ eigentlich ist. Das misslingt ihm jedoch, weil es dem Text an Tiefe fehlt. Der Autor verliert sich aus meiner Sicht in verschiedensten Punkten, die allesamt nicht wirklich helfen, seine Thesen zu stützen. Stattdessen entwertet er die Diskussion insgesamt, indem er es viel zu schnell abbricht. Man merkt, dass der vorliegende Text eher ein Essay als ein Buch ist, eher Denkanstöße geben möchte als wirklich Lösungen zu bieten. Dabei bleibt der Versuch allerdings auf halber Strecke liegen. Denn die Denkanstöße sind bei weitem nicht klar und schon gar nicht einfach so verständlich.
Wenn ich das Buch zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es ist eine Kritik an Imperialismus, an Kolonialismus, an Eurozentrismus an wissenschaftlichen Forschungsmethoden und Ansichten, insbesondere in den Wissenschaften der Philosophie. Es bleibt aber inhaltlich sehr schwach und wirklich eine neue Erkenntnis zum Thema Islam oder Muslime liefert Griffel nicht. Auch seine Betrachtungen zu historischen Entwicklungen sind meiner Meinung nach eher zu schwammig als greifbar und verständlich.
Ein gefundenes Fressen für die Opferrolle
Der Autor hat sich stets bemüht das Thema Islam aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten. Letztlich bleibt es aber auch eine Perspektive, die man gemeinhin als „Opferrolle“ bezeichnen kann. Kein Wunder also, wenn bestimmte Kreise, insbesondere unter Muslimen, die Kritik von Griffel hypen und das Buch sakrosankt loben. Es bleibt aber letztlich eine Arbeit, die mittelmäßig erscheint. Dabei ist man vom Professor for Islamic Studies an der Yale University interessantere Beiträge und Arbeiten gewohnt.
Ein Beispiel ist die Einführung in Ghazalis Philosophische Theologie. Wer das englischsprachige Buch „Al-Ghazali’s Philosophical Theology“ von Griffel kennt und die jetzige Arbeit betrachtet stellt enorme Unterschiede in der Qualität und vor allem in der Sichtweise fest. Dabei hätte Griffel in seiner jetzigen Arbeit auch auf diese frühere Arbeit aufbauen und zumindest auch Ghazali stärker betrachten können. Das hat er vermieden und sich eher auf Exegeten (weniger Philosophen) wie Fahraddin ar-Razi bezogen.
Kritik und innermuslimischer Diskurs wird nicht betrachtet
Vielleicht liegt auch hier das Problem der Arbeit. Ghazali hat Philosophie und Theologie vereint, Farabi und Averroes haben wie Ghazali massive Kritik an Avicenna und seiner Philosophie geübt, indem sie aber auch andere Ansätze und Ansichten vertreten haben. Dieser innermuslimische und fachliche Diskurs fehlt gänzlich in diesem Buch. Dies hätte aber zwangsläufig erfolgen müssen, wenn man sich mit den Themen Ambiguität, Fundamentalismus, muslimische Kultur und Moderne beschäftigt und dies als Autor immer wieder am Bespiel der Philosophie zeigen möchte.
Im Grunde kann man sich daher dieses Buch sparen. Der Abschnitt 3, „Islamic philosophy“, von Hossein Ziai im „The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology“ und das Buch „Kultur der Ambiguität“ von Thomas Bauer sind eine bessere Lektüre als der Essay von Griffel, wobei Griffel selbst in seiner Arbeit z.T. auf die Erkenntnisse aus Kultur der Ambiguität zurückgreift. Man lernt bei beiden Büchern allerdings auch wirklich etwas über „den“ Islam.
Autor: Frank Griffel
Buch: Den Islam denken: Versuch, eine Religion zu verstehen
Seiten: Angabe vom Verlag 102, tatsächlich rund 90
Verlag: Reclam
ISBN: 978-315-0195-482